Im Aquaponik-System des Berliner Fisch-Forschers Bernhard Rennert wachsen Tomaten mit Nährstoffen aus den Exkrementen der Fische, die im gleichen Gewächshaus leben. Das Prinzip ist nicht neu. Ob das System für die Praxis taugt, steht aber noch in den Sternen.
 Spezialisierung ist im Gemüsebau so etwas wie das Gebot der Stunde. Wie wäre es mit einer Diversifizierung? Mit einer Fischzucht beispielsweise? Auf den ersten Blick haben Tomaten und Fische wahrlich nicht vieles gemeinsam. Dafür auf den zweiten: Stellt man es nämlich schlau an, können beide sogar voneinander profitieren. Das Stichwort dazu heisst Aquaponik. Dabei ernähren sich Tomaten von den Exkrementen der Fische. Die Pflanzen ihrerseits reinigen das Wasser, in dem die Fische schwimmen. Ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Prinzip, das sich in der Natur seit langem bewährt.
Spezialisierung ist im Gemüsebau so etwas wie das Gebot der Stunde. Wie wäre es mit einer Diversifizierung? Mit einer Fischzucht beispielsweise? Auf den ersten Blick haben Tomaten und Fische wahrlich nicht vieles gemeinsam. Dafür auf den zweiten: Stellt man es nämlich schlau an, können beide sogar voneinander profitieren. Das Stichwort dazu heisst Aquaponik. Dabei ernähren sich Tomaten von den Exkrementen der Fische. Die Pflanzen ihrerseits reinigen das Wasser, in dem die Fische schwimmen. Ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Prinzip, das sich in der Natur seit langem bewährt.
Bereits in den 70er- und 80er-Jahren befassten sich weltweit verschiedene Forscher mit der integrierten Fisch- und Gemüseproduktion. So auch Bernhard Rennert vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), damals noch in der DDR. Die Genossen von damals hatten aber schliesslich wenig Interesse am umweltfreundlichen System. «Die Umwelt spielte bei denen keine Rolle», sagt der Fisch-Forscher. Doch die Zeiten haben sich geändert, nicht nur, dass es die DDR mittlerweile nicht mehr gibt. Bevölkerungsexplosion, knappe Nahrungsmittel, Umweltverschmutzung und Klimawandel bereiten der Menschheit Sorgen. Die Fischerei spielt dabei eine nicht allzu positive Rolle: Die durch Aquakulturen verursachten Gewässerverschmutzungen nehmen weltweit zu. Somit war der Zeitpunkt gekommen, das Projekt von damals wieder aus der Schublade zu holen. Das deutsche Bundesministerium für Forschung und Bildung unterstützte das Projekt finanziell mit einem Beitrag von rund 800’000 Euro.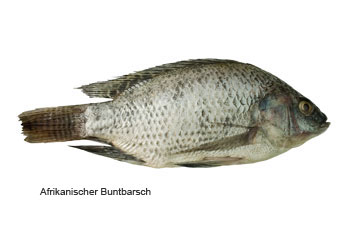
600 kg Tomaten geerntet
So entstand am Ufer des Berliner Müggelsees das kleine aber feine High-Tech-Gewächshaus, in dem nicht nur afrikanische Buntbarsche (Tilapia) in ihren Becken herumschwimmen, sondern gleich nebenan auch noch gerade Tomaten wachsen. Dabei wird eine sonst übliche Hydroponikanlage zur Produktion von Gemüse, die nach dem Prinzip der Nährfilmtechnik (NFT) betrieben wird, zu einer Aquaponik-Anlage kombiniert. Die Fische scheiden Ammoniak aus, dazu kommen Phosphat, Kalzium und Spurenelemente. Bevor die Nährstoffe in die Pflanzrinnen zu den Tomaten fliessen, durchlaufen sie ein ausgeklügeltes Filtersystem. «Dabei wird das Ammoniak in für Pflanzen verfügbares Nitrat umgewandelt», erklärt Bernhard Rennert. Die Tomaten wachsen erdlos in den Pflanzrinnen und die Wurzelballen stehen direkt im Wasser mit den natürlich aufbereiteten Nährstoffen. 600 Kilogramm Tomaten der Sorte «Ferrari» wurden im letzten Jahr immerhin geerntet, neben 200 Kilogramm Fischen. «Die Tomaten schmeckten nicht nach Fischen», sagt Bernhard Rennert augenzwinkernd. Von Krankheiten und Schädlingen blieben die Pflanzen weitgehend verschont. Doch was wäre wenn? «Dann müssten wir mit biologischen Bekämpfungsmethoden arbeiten», sagt der Fisch-Spezialist. Denn die empfindlichen Fische würden die herkömmlichen Pflanzenschutzmittel nicht ertragen.
Eine teure Sache
Die Pflanzrinnen, wo sonst die Tomaten wachsen, sind an diesem Tag im Februar leer. Die Setzlinge werden zurzeit in einem anderen Gebäude aufgezogen und sollen im März eingepflanzt werden. Während draussen der See gefroren ist, herrschen im Gewächshaus angenehm warme Temperaturen vor, fast schon tropisch. Das ist nötig, denn die Tilapia-Fische stammen ursprünglich aus Afrika und brauchen entsprechende Temperaturen, im Wasser 25 Grad. Züchter verwenden die exotische Fischsorte gerne, weil sie schnell wächst und viel Eiweiss enthält. Die Jungfische stammen aus der eigenen Zucht. Die Energie für Steuerung, Heizanlage, Klimaanlage und Filteranlagen liefern Solarzellen von einem Nebengebäude und zwei Wärmepumpen ins Gewächshaus. Energieautark ist die Anlage zwar nicht ganz. Effizient aber schon. Die Berliner Forscher haben sich zum Ziel gesetzt, den täglichen Wasserverlust des ganzen Systems auf maximal drei Prozent zu beschränken. Selbst das Wasser, das die Pflanzen als Wasserdampf abgeben, wird über einen Kondensationsfilter aufgefangen und gelangt ins System zurück.
Minimaler Wasser- und Energieverbrauch in einem nahezu geschlossenen Kreislauf, das sind die Hauptziele des Projektes. Von aussen ins System rein kommen Fischfutter, Sonnenenergie und sehr wenig Wasser. Raus gehen die Tomaten, die Speisefische und Schlammabfälle. «In der Praxis sehe ich eine solche Aquaponik- Anlage vor allem in ariden Gebieten mit knappen Wasservorräten», sagt Forscher Bernhard Rennert. Die Praxistauglichkeit soll in diesem Jahr erreicht und Kinderkrankheiten ausgemerzt werden. Eine wichtige Rolle beim Ganzen spielen die Kosten: Die Anlage in Berlin kostete umgerechnet rund 1,2 Millionen Franken, für eine Fläche von 167m2. Obwohl es sich um eine Art Prototyp handelt, stellt sich natürlich die Frage, ob das System für die Praxis nicht zu teuer ist? «Es sind auch abgespeckte Varianten denkbar», sagt Rennert dazu. Ein Student befasse sich zudem im Rahmen einer Masterarbeit mit der betriebswirtschaftlichen Seite des Projektes.
Anlage vor allem in ariden Gebieten mit knappen Wasservorräten», sagt Forscher Bernhard Rennert. Die Praxistauglichkeit soll in diesem Jahr erreicht und Kinderkrankheiten ausgemerzt werden. Eine wichtige Rolle beim Ganzen spielen die Kosten: Die Anlage in Berlin kostete umgerechnet rund 1,2 Millionen Franken, für eine Fläche von 167m2. Obwohl es sich um eine Art Prototyp handelt, stellt sich natürlich die Frage, ob das System für die Praxis nicht zu teuer ist? «Es sind auch abgespeckte Varianten denkbar», sagt Rennert dazu. Ein Student befasse sich zudem im Rahmen einer Masterarbeit mit der betriebswirtschaftlichen Seite des Projektes.
Zwei Ernten
Die Vorteile des Systems sind zwar vielfältig: wenig Emissionen, Düngereinsparung bei der Gemüseproduktion sowie die Doppelnutzung von Wasser, Heizenergie und Bauhülle. Und bei der Zusammensetzung des Fischfutters gibt es noch einige Optimierungsmöglichkeiten. Zurzeit besteht es vor allem aus Fischmehl, dessen Ruf in punkto Nachhaltigkeit und Ökologie nicht der beste ist. Man sei auf der Suche nach Alternativen. Von der Marktreife des von der IGB patentierten Systems ist man noch ein Stück entfernt. Bei den Fischen und Tomaten aus Berlin selbst bestehen allerdings keinerlei Absatzprobleme: Sie werden unter den Forschenden der IGB aufgeteilt, die sich um die Delikatessen reissen.
Interview
Aquaponik: Etwas für Schweizer Gemüseproduzenten?
Der Umweltnaturwissenschafter Andreas Graber von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil experimentiert seit 2003 mit einem Aquaponik-System. Vor vier Jahren setzte er das System bei einem Landwirt in Donat GR ein. Dieser züchtete Forellen und zog u. a. Erdbeeren und Küchenkräuter. Allerdings nur zwei Jahre lang. Nun sucht der Forscher neue Interessenten für das System, zum Beispiel Gemüseproduzenten.
Weshalb soll ein Schweizer Gemüseproduzent neben Tomaten auch noch Fische produzieren?
In Australien haben gewinnorientiert operierende Aquaponik-Anlagen gezeigt, dass man mit 1.2 kg Fischfutter nicht nur 1 kg Frischfisch produzieren kann, sondern mit dem entstehenden Abwasser bis 10 kg Gemüse. Das Abwasser aus Fischzuchtanlagen ist ein vollwertiger Pflanzendünger. Es wäre schlicht Ressourcenverschwendung, diese Nährstoffe ungenutzt als Abwasser zu entsorgen.
Nur die wenigsten Gemüseproduzenten verstehen etwas von Fischzucht. Ist das nicht ein Problem?
Das ist eine lösbare Herausforderung, denn keine wichtige Branche in der Lebensmittelproduktion bringt Erfahrung in der Fischzucht mit. Die Gemüseproduktion erfordert Fachkräfte, die sich auch mit Fischzucht vertraut machen können. Bezüglich Aquaponik hat der Gemüsebau die besten Voraussetzungen. Mit dem Gewächshaus ist die wichtigste Infrastruktur bereits vorhanden. Die beiden Profitzentren Aquakultur und Hydroponic sind finanziell etwa gleichbedeutend, somit steht bereits die halbe Anlage.
Mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen, wenn man ein Aquaponik-System installieren möchte? Gibt es auch vereinfachte Varianten?
Die Wahl des Fischzuchtsystems hängt von verschiedenen Standortfaktoren ab. In einem 1’000 m2 Gewächshaus beispielsweise könnte auf 100 m2 eine Fischzucht mit 50 m3 Wasser installiert werden, die den Nährstoffbedarf der Kulturen abzudecken vermag. Jährlich können rund 5 t Frischfisch produziert werden. Eine solche Anlagentechnik kostet rund 120’000 CHF. Eine einfache Versuchsanlage mit 3 m3 Wasser kann rund 200 kg Fisch pro Jahr liefern, Kostenpunkt 12’000 CHF.
Kann Aquaponik für Rinnen- und Tropfbewässerung eingesetzt werden?
Ja, allerdings unterschiedlich. Ideal ist eine Rinnenbewässerung: die Pflanzen sollen ja das Fischwasser reinigen, daher muss das gesamte Fischwasser zweimal pro Stunde über den Pflanzenfilter gepumpt werden. Tropfbewässerung eignet sich zur Verwertung des Fischwassers ohne Rückfluss zum Fischbecken, in diesem Fall ist zusätzlich ein Biofilter erforderlich. In diesem System spielt der Wärmeverlust in der Hydroponic keine Rolle, somit sind auch Pflanzkulturen im Freiland möglich.
Gibt es einen Markt für die Fische?
Ja, die Schweiz importierte 2005 rund 93 Prozent des Fischkonsums, wöchentlich sind das 1’000 t Fisch. Nachhaltig produzierter Fisch muss einen Lokalbezug haben, finde ich. Der Gemüsebau verfügt bereits über gut differenzierte und täglich aktive Vermarktungsnetze, so dass Frischfisch gemeinsam mit Gemüse gehandelt werden könnte.
www.aquaponic.ch
(Publiziert in „Der Gemüsebau/Le Maraîcher“ von März 2009)
Bildergalerie (anklicken für Dia-Show):








top beitrag, einfach zu verstehen und informativ! ich freue mich, dass langsam immer mehr auf aquaponik aufmerksahm werden und die nachhaltige methode publik machen! ich würde mich sehr freuen wenn du mal auf dem deutschen aquaponik-forum.de (http://aquaponik-forum.de) vorbeischauen könntest.
bis bald
Afrikanische Buntbarsche lassen Tomaten spriessen…
Im Aquaponik-System des Berliner Fisch-Forschers Bernhard Rennert wachsen Tomaten mit Nährstoffen aus den Exkrementen der Fische, die im gleichen Gewächshaus leben. Das Prinzip ist nicht neu.
……
[…] eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus » Afrikanische Buntbarsche lassen Tomaten spriessen […]
Guten Tag Herr Bernd Renner.
In Kenya -ab 1981 bis Ende 1999- versuchte ich -vorallem den
ackerbauenden Kikuyu-Frauen- beizubringen: Tilapia-Teiche +
Gemüse-Beete. Da ich „der Erste“ mit dieser Idee war, + außerdem
ohne! $/DM!- hatte ich zwar viele „Interessentinnen“, jedoch niemanden der solche „exotischen“ Gartenmethoden -lange genug- ausprobieren wollte. gtz u.ä. hatten „dafür Kein! Geld“ übrig! – Die wollten „nur“ „industrielle“ = chemiehaltige Methoden
fördern.-
Warum zeigen Sie nicht Tilapia mocambique/ca Männchen = im
„Treiber“/Brut-Farbkleid?? = mit „Ei-Punkten“?
Solche „Fisch-Gemüse-Beet“-Kulturen instaliierten -vor 1980- Deutsche Frauen auch schon im Urwald von Brasilien = jetzt wohl -von Monsanto + Co- zerstört – zugunsten von Soja-Monokultur- Terror?
Gruß Siegfried Gerber gerufen: „Bwana Compost“, „Mr. Trees“, „Bwana-Samaki“ u.v.m. „Titel“ in Kenya.