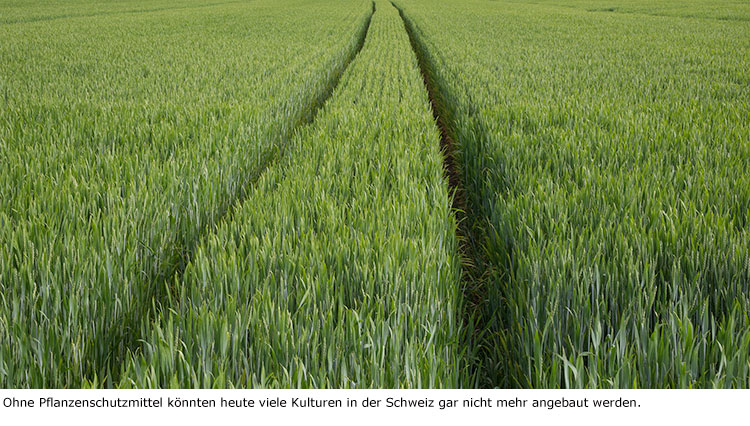 Karotten, Kartoffeln und Äpfel müssen heute Kriterien erfüllen, wie sie bei Industrieprodukten gelten. Einheitlich, ohne Fremdstoffe und in perfekter Farbe liegen sie im Verkaufsregal auf. Ohne die Hilfe von Pflanzenschutzmitteln wäre das aber kaum möglich.
Karotten, Kartoffeln und Äpfel müssen heute Kriterien erfüllen, wie sie bei Industrieprodukten gelten. Einheitlich, ohne Fremdstoffe und in perfekter Farbe liegen sie im Verkaufsregal auf. Ohne die Hilfe von Pflanzenschutzmitteln wäre das aber kaum möglich.
Sie tragen seltsame Namen wie Cypermethrin, Dimethenamid-P oder Glyphosat und sind bei einem grossen Teil der Bevölkerung alles andere als Sympathieträger. Wer ihnen trotzdem wohlgesinnt ist, nennt sie Wirkstoffe, die anderen sprechen eher von Gift. Bei den Pflanzenschutzmitteln kreisen die Gedanken vieler zuerst um tote Tiere, vergiftete Flüsse oder kranke Menschen. Kaum jemand denkt an jederzeit im Regal verfügbare, äusserlich perfekte Kartoffeln oder Äpfel, was die andere Seite der Medaille wäre. «Mich stört, dass bei Pflanzenschutzmitteln immer nur von den negativen Seiten gesprochen wird», sagt Olivier Félix, Leiter Fachbereich Pflanzenschutzmittel im Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Bei vielen Kulturen sei der Anbau in der Schweiz oft nur dank der Hilfe von Wirkstoffen erst möglich. Beispielsweise Kartoffeln oder Weinreben, bei denen ohne Behandlungen die Krautfäule respektive der Mehltau für grosse Ernteausfälle sorgen würden.
 Wenn keine Blattlaus mehr erlaubt ist
Wenn keine Blattlaus mehr erlaubt ist
Die Anforderungen an Landwirtschaftsprodukte werden immer strenger: Kam es vor ein paar Jahren noch vor, dass auf einem gekauften Kopfsalat eine Blattlaus herumkrackselte, herrscht heute bei den Abnehmern diesbezüglich Nulltoleranz. Spezielle auf Blattlausresistenz gezüchtete Salatsorten helfen dem Gemüseproduzenten nur noch teilweise, das Problem unter Kontrolle zu halten. Denn der Schädling hat mittlerweile Wege gefunden, die Resistenzen zu durchbrechen. Viele Gemüseproduzenten verwenden deshalb präventiv ein Insektizid gegen Blattläuse. Ein anderes Beispiel: Der Handel toleriert bei Äpfeln oder Kartoffeln seit Jahren keine Schorfflecken mehr, obwohl es sich dabei nur um ein ästhetisches Problem handelt. Kundinnen und Kunden akzeptierten keinen Silberschorf auf den Kartoffeln, zitierte die Bauernzeitung kürzlich dazu den Migros-Mediensprecher. Da bleibt dem Bauern nicht viel anderes übrig, als den entsprechenden Wirkstoff gegen den Pilz oder Schädling einzusetzen. Denn das Risiko trägt er selbst: niemand bezahlt ihm etwas, wenn er die Ware nicht verkaufen kann. Die genannten Beispiele zeigen: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln steht in einem engen Zusammenhang mit den hohen Ansprüchen der Abnehmer respektive der Kundschaft. Agrarprodukte wären eigentlich Naturprodukte, müssen heute aber Kriterien erfüllen, wie sie aus der Industrie bekannt sind: gleichförmig, frei von Fremdstoffen und dazu noch billig müssen sie sein. Der Preisdruck seinerseits macht ein rationelleres Arbeiten auf dem Acker nötig. Mehr Maschineneinsatz, grössere Schläge, weniger Kulturen oder engere Fruchtfolgen sind die Konsequenzen. Wenn beispielsweise Zwiebeln zwecks Ertragssteigerung enger gepflanzt werden, sind sie potenziell anfälliger auf Krankheiten. Und das Unkraut kann nicht mehr mechanisch mit einer Hacke bekämpft werden, weil die Reihen zu eng sind.
Weniger Wirkstoffe zugelassen
Der jährliche Pestizid-Einsatz hat sich in der Schweiz bei einer Menge von rund 2000 Tonnen eingependelt, je nach Witterungsbedingungen ist es etwas mehr oder weniger. Die Anzahl der zugelassenen Stoffe nimmt eher ab, was vor allem technische Gründe hat. Im Rahmen der üblichen Harmonisierung mit EU-Recht wurde die Schweizer Pflanzenschutzmittelverordnung an die entsprechende EU-Verordnung angepasst. «In den letzten Jahren wurde deshalb bei alten Wirkstoffen eine Neubeurteilung der toxischen Wirkung vorgenommen», sagt Olivier Félix. Etwa ein Viertel der Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln wurden als Folge nicht mehr erneuert. Unter anderem auch weil die global agierenden Pflanzenschutzfirmen den Aufwand für das Einreichen von Dokumenten im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als zu hoch betrachten für den im Vergleich «unbedeutend» kleinen Schweizer Markt. Dabei geht es vor allem um die relativ hohen Kosten für notwendige Feldversuche und Rückstandsanalysen. Das hat zur Folge, dass vor allem bei Kulturen immer öfter wirksame Pflanzenschutzmittel fehlen, die in der Schweiz im internationalen Vergleich nicht so häufig angebaut werden, wie beispielsweise Knollensellerie oder Buschbohnen. In solchen Fällen haben die Landwirte dann ein echtes Problem.
 Mehr Ertrag und weniger Anbaufläche
Mehr Ertrag und weniger Anbaufläche
Die Anbaufläche für Landwirtschaftsprodukte wird in der Schweiz immer kleiner, der Selbstversorgungsgrad mit immer mehr Einwohnern soll aber gehalten werden. Ohne chemische Pflanzenschutzmittel und Dünger wird die dafür nötige Ertragssteigerung nicht zu erreichen sein. Immerhin geben sich die Bauern in der Schweiz grösste Mühe, sich in diesem schwierigen Umfeld möglichst umweltfreundlich zu verhalten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist heute eingebettet in ein ganzes Anwendungssystem, bei dem sie oft erst zum Einsatz kommen, wenn eine gewisse Schadschwelle von Schädlingen oder Krankheitsbefall erreicht ist. Präventive Massnahmen wie Fruchtfolgen, die Verwendung von resistenten Sorten oder der Einsatz von Nützlingen spielen heute bei den Bauern eine viel grössere Rolle als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem ist der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln aus genannten Gründen oft nötig. Die so genannte gute Agrarpraxis empfiehlt dabei, dass jeweils zwischen den Wirkstoffen abgewechselt wird, um zu verhindern, dass Unkräuter, Schädlinge oder Pilze Resistenzen entwickeln. Aus dem gleichen Grund und weil die Pflanzenschutzmittel spezifischer wirken – eines gegen Schädling X, das andere gegen den Pilz Y –, kommen deshalb manchmal mehrere Mittel bei der gleichen Kultur zum Einsatz. Dabei kann es zu sogenannten Mehrfachrückständen von Wirkstoffen kommen, über deren schädliche Wirkung in den Medien kontrovers diskutiert wird. Die Abnehmer haben als Reaktion auf die negativen Meldungen vorsorglich die Anzahl erlaubter Wirkstoffe auf einer Kultur begrenzt. Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist das auf den ersten Blick positiv. Auf den zweiten allerdings nicht unbedingt (siehe Kasten).
Toleranzwerte kaum überschritten
Die Zeiten von Arsen oder DDT auf Schweizer Äckern gehören glücklicherweise längstens der Vergangenheit an. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft reagiert ein grosser Teil der Bevölkerung trotzdem immer noch skeptisch. Niemand will schliesslich «giftige» Stoffe in der Natur und schon gar nicht in den Lebensmitteln. Zumindest aus wissenschaftlicher Sicht ist das aber auch nicht der Fall. Das gesetzliche Bewilligungsverfahren ist streng und die Anwendung – Mengen, Anzahl Spritzungen oder einzuhaltende Wartefristen – ist jeweils für jedes Produkt strikt geregelt. Bei den in Schweizer Früchten und Gemüsen durchgeführten Rückstandsanalysen liegt die Anzahl der beanstandeten Proben wegen überschrittener Toleranzwerte oder nicht zugelassenen Wirkstoffen seit Jahren zwischen zwei und vier Prozent. Wobei Toleranzwert nicht gleich Grenzwert ist, erst bei letzterem ist nämlich per Definition mit negativen Folgen für die Gesundheit zu rechnen.
Heutige Pflanzenschutzmittel wirken spezifischer als ihre Vorgänger vor ein paar Jahrzehnten, trotzdem müssen sie eine «zerstörende» Wirkung haben. Da gibt es nichts schön zu reden. Das gilt übrigens auch für im Biolandbau zugelassene Pflanzenschutzmittel, die mehr auf pflanzlichen Giften basieren aber ebenfalls das ordentliche Zulassungsverfahren des Bundes bestehen müssen. Die Biobauern kämpfen oft mit den gleichen Schädlingen und Krankheiten wie ihre konventionellen Kollegen. Ernteverluste können sie durch die etwas höheren Preise noch eher abfedern. Allerdings nimmt auch hier der Preisdruck zu, ebenso die Qualitätsanforderungen: Schrumpelige oder fleckige Bioäpfel können heute auch nicht mehr verkauft werden. Selbst bei der vermeintlich etwas sensibilisierten Kundschaft. Eine Entwicklung, die vielen Biobauern Sorgen macht.
Der idyllische Bauernhof von nebenan mit dem Hahn, der auf dem Miststock kräht, mag gut in die Werbebroschüren der Abnehmer passen. Der gleichzeitig aufgelegte Aktionsflyer ist aber das eigentliche Problem.
Lesen Sie dazu mehr dazu in diesem LID-Dossier


Kommentare