 Kulturen sind langfristig erfolgreicher, wenn genug Bodenbakterien und -pilze vorhanden sind. Ein Anbauberater rät deshalb zu einer vielfältigeren Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten. Diese würden für mehr Leben im Boden sorgen.
Kulturen sind langfristig erfolgreicher, wenn genug Bodenbakterien und -pilze vorhanden sind. Ein Anbauberater rät deshalb zu einer vielfältigeren Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten. Diese würden für mehr Leben im Boden sorgen.
Es gebe nichts Schlimmeres für einen Boden als Dämme und Monokulturen, die darauf wachsen. Mit diesen Worten startete der Anbauberater Christoph Felgentreu in sein Fachreferat. Pikant dabei: im Publikum sassen vor allem Spargel-anbauer. Sie besuchten im November den Spargeltag, der anlässlich der europäischen Spargel- und Erdbeerbörse in Karlsruhe zum 24. Mal stattfand. Manchmal müsse man den Landwirten den Spiegel vorhalten, sagte Felgentreu, der für die Deutsche Saatveredelung AG in Lippstadt arbeitet. Und das tat er. Er zeigte vorerst ein düsteres Bild über den Zustand der landwirtschaftlichen Böden auf. Diese würden an Humusschwund, Erosion, Verschlämmung und dem Verlust der Fruchtbarkeit leiden. Stagnierende oder fallende Erträge oder mehr Schädlings- und Unkrautdruck seien die Folgen. Das liege vor allem an der zu intensiven Nutzung, bei der dem Bodenleben zu wenig Beachtung geschenkt werde. Als Lösungsbringer betrachtet Felgentreu den Anbau von Zwischenfrüchten. «Leider setzen viele Bauern diese nicht richtig ein», sagte der Zwischenfruchtexperte. Er nahm die Tagungsteilnehmer deshalb zuerst auf eine recht anspruchsvolle Reise mit durch die Welt der Bodenbakterien und -pilze, die für einen grossen Teil der «Arbeit» im Boden zuständig seien. «Kein Bodenbearbeitungsgerät leistet ähnliches wie sie.» Schon gar nicht der Pflug, denn dieser zerstöre die geschaffenen Strukturen im Boden auf einen Schlag.
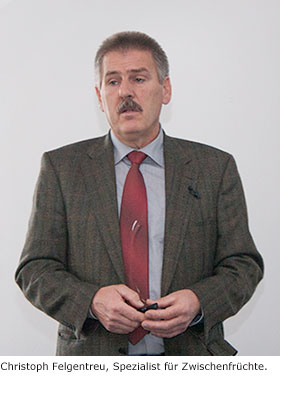 Wurzeln sondern Stoffe ab
Wurzeln sondern Stoffe ab
Die Bakterien und Pilze lebten vor allem von den Wurzelausscheidungen, den sogenannten Exsudaten. Die wichtigste Aufgabe der Wurzel sei nämlich laut Felgentreu nicht die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen aus dem Boden für die Pflanze, sondern die Fütterung der Bodenlebewesen mit diesen Exsudaten. Bei Schwarzbrachen nähme die Aktivität der Mikroorganismen deshalb schnell ab. Besonders wichtig seien die Actinomyceten, die schwer abbaubare Substrate wie Lignin, Chitin und Stärke verwerten. Bei der Mykorrhiza gehen Pilze mit den Wurzeln eine Symbiose ein. Durch das feine Pilzgeflecht kann die Pflanze Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor oder Kalium effektiver aufnehmen. Damit Folgekulturen auch von der Mykorrhiza profitieren könnten, seien aber Brückenkulturen nötig oder eben die Zwischenfrüchte.
Schwarze Abdeckfolien sind problematisch
Als problematisch für den Boden erachtete Felgentreu die bei den Spargeln oft verwendeten schwarzen Folien, die eine Temperaturregulierung verunmöglichten. Bei praller Sonne und ab Temperaturen von 60 Grad Celsius – was unter der schwarzen Folie schnell erreicht sei –, ginge es dem grössten Teil der Bodenlebewesen an den Kragen. Und Wasser verdunste von der Pflanze ungenutzt. Nicht aber, wenn zwischen den Spargeln Zwischenfrüchte stünden, die eine Beschattung des Bodens und den Luftaustausch ermöglichten. Schon eine Mulchschicht bringe viel. «Der Wohlfühlbereich der Pflanze befindet sich bei 20 Grad Celsius», sagte er.
Zwischenfrüchte dürften keine Monokulturen sein, das sei einer der häufigsten Fehler, der gemacht werde, beispielsweise mit Senf. Denn die Zusammensetzung von Bodenbakterien und -pilzen müsse ebenfalls eine gewisse Vielfalt aufweisen, damit sie ihre vielfältigen Aufgaben im Boden wahrnehmen könnten. Denn jede Pflanze habe ihr eigenes Milieu, erklärte er. Bei Monokulturen fehlten dann Antagonisten der Folgepflanze und machten diese möglicherweise anfälliger auf Schädlinge. Felgentreu plädiert deshalb bei Zwischensaaten auf Mischungen, wie beispielsweise dem Landsberger Gemenge. Die Herausforderung zukünftiger Pflanzenbausysteme läge darin, die richtige Kombination von Pflanzenarten nacheinander und untereinander zu finden. Seine Firma entwickelt eigene Mischungen für Zwischenfrüchte. Den anwesenden Landwirten empfahl er, mehr auf pfluglose Anbausysteme – beispielsweise Mulchsaat –, innovative Fruchtfolgen und Untersaaten zu setzen. Dadurch werde die Unkrautunterdrückung, der Schädlings- und Krankheitsdruck oder der Verdunstungsschutz positiv beeinflusst und die Bodenstruktur bleibe intakt. «Die Effekte wiegen den Zusatzaufwand mehrfach auf.»
Kritik aus dem Publikum
Die griffig vorgetragenen Ausführungen des Anbauberaters stiessen beim Publikum nicht nur auf Gegenliebe. Es entstehe der Eindruck, dass alle Spargelanbauer schlechte Landwirte seien. Die allgemein bekannte Tatsache, dass gerade Erdbeeren nach Spargeln besonders gut wachsen würden, stehe dem im Referat vermittelten Bild des «toten» Spargel-Bodens diametral entgegen. Dem entgegnete Felgentreu, dass das an den meterlangen Wurzelsystemen der Spargeln liege, deren Wirkung aber schnell nachlasse, weil die Wurzeln keinen Nachschub mehr von oben erhalten und die «Fütterung» der Mikroorganismen im Boden ausbleibe.
Anbauversuche in Deutschland
Im Anschluss an das Referat präsentierte die Spargelberaterin Isabella Kokula vom Landratsamt Karlsruhe Ergebnisse einer Praxisdemo mit Begrünungsmischungen im Spargelanbau. Wichtig sei, dass die Aussaat bis spätestens 15. August erfolge und das nur auf 60 bis 80 cm Breite, um die Durchlüftung zu gewährleisten. Vier verschiedene Mischungen wurden ausprobiert. Am besten habe ihr die Mischung aus Hafer, Buchweizen, Peluschken, Perserklee, Alexandrinerklee und Calendula gefallen. Der Versuch muss allerdings noch weitergeführt werden, dabei soll im nächsten Jahr das Bodenleben analysiert und die Bodendichte erfasst werden, so Kokula.
Eigenschaften von einigen ausgewählten Zwischenfruchtkulturen:
Trockenkeimer: Bitterlupine, Öllein, Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Buchweizen, Peluschke
Tiefwurzler: Bitterlupine, Alexandrinerklee, Gelbsenf, Sommer-Wicke, Ölrettich, Steinklee, Luzerne, Markstammkohl
Flachwurzler: Rauhafer, Ramtillkraut, Buchweizen, Gräser
Polwurzler: Bitterlupine, Phacelia, Alexandrinerklee, Gelbsenf, Ölrettich, Raps, Rübsen, Sonnenblume
Schattengarebildner: Phacelia, Ramtillkraut, Sommerwicker
N-Sammler: alle Leguminosen
P-Aufschluss: Phacelia (org.), Buchweizen, Gelbsenf, Weisse Lupine (anorg.)
Si-Aufschluss: Öllein
Allelopathen: Rauhafer
Mykorrhizierer: Phacelia, Rauhafer, Ramtillkraut, viele Leguminosen, alle Gräser

Kommentare